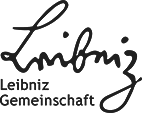Was bewegt die Landwirtschaft von morgen? Entdecken Sie die neue Online-Wissensthek querFELDein der Leibniz-Gemeinschaft
 Die Online-Wissensthek "querFELDein" bündelt Fakten, News und Ideen rund um die Landwirtschaft der Zukunft.
Die Online-Wissensthek "querFELDein" bündelt Fakten, News und Ideen rund um die Landwirtschaft der Zukunft.
Sie bringt dabei Perspektiven aus Forschung, Praxis und Gesellschaft zusammen und lädt zum Dialog ein.
Der Wandel hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft ist von großer Bedeutung für die Gesellschaft und betrifft uns alle.
Haben Sie Fragen, Ideen oder Anregungen?
Dann diskutieren Sie mit!

 Was fordert „Fridays for Future“ konkret? Wie können die Forderungen in unseren Städten und Regionen umgesetzt werden? Wie kann Stadt- und Raumplanung unterstützen – und sollte sie? Stadt- und Raumplanung bilden die wichtige Schnittstelle zwischen dem Erstarken politischer Bewegungen und deren Übersetzung auf räumliche Veränderungen. Aufbauend auf einen Input aus der Bewegung „Fridays for Future“ wollen wir in verschiedenen Themengruppen mögliche Umsetzungsszenarien gemeinsam entwickeln.
Was fordert „Fridays for Future“ konkret? Wie können die Forderungen in unseren Städten und Regionen umgesetzt werden? Wie kann Stadt- und Raumplanung unterstützen – und sollte sie? Stadt- und Raumplanung bilden die wichtige Schnittstelle zwischen dem Erstarken politischer Bewegungen und deren Übersetzung auf räumliche Veränderungen. Aufbauend auf einen Input aus der Bewegung „Fridays for Future“ wollen wir in verschiedenen Themengruppen mögliche Umsetzungsszenarien gemeinsam entwickeln. The German Academy for Spatial Research and Planning (ARL), investigates space both in terms of its physical structure and as a part of societal processes, and analyses pathways towards sustainable spatial development. The Academy addresses the economic, social, ecological, technological and cultural conditions of spatial development and the spatial effects of human activities, providing an innovative perspective on the complex challenges of future societies. As a multi-disciplinary network of experts from academia and practice, the ARL stimulates research activities and provides academic consultancy services. Inter- and transdisciplinary academic working groups at different scales ensure high quality scholarship. To establish an international working group (IAK) on
The German Academy for Spatial Research and Planning (ARL), investigates space both in terms of its physical structure and as a part of societal processes, and analyses pathways towards sustainable spatial development. The Academy addresses the economic, social, ecological, technological and cultural conditions of spatial development and the spatial effects of human activities, providing an innovative perspective on the complex challenges of future societies. As a multi-disciplinary network of experts from academia and practice, the ARL stimulates research activities and provides academic consultancy services. Inter- and transdisciplinary academic working groups at different scales ensure high quality scholarship. To establish an international working group (IAK) on  This edited volume is the result of a three-year International Working Group of the ARL on metro regions.
This edited volume is the result of a three-year International Working Group of the ARL on metro regions. Das von Thorsten Wiechmann (TU Dortmund) herausgegebene Sammelwerk präsentiert debattenbestimmende Originaltexte bekannter Autor/innen. Diese werden durch namhafte Planungswissenschaftlicher/innen eingeordnet und kritisch diskutiert. Damit bietet der Band einen bisher nie dagewesenen Überblick über die Grundlagen der aktuellen planungstheoretischen Debatten für Studierende der Raum- und Planungswissenschaften sowie fachlich interessierte aus Wissenschaft und Praxis.
Das von Thorsten Wiechmann (TU Dortmund) herausgegebene Sammelwerk präsentiert debattenbestimmende Originaltexte bekannter Autor/innen. Diese werden durch namhafte Planungswissenschaftlicher/innen eingeordnet und kritisch diskutiert. Damit bietet der Band einen bisher nie dagewesenen Überblick über die Grundlagen der aktuellen planungstheoretischen Debatten für Studierende der Raum- und Planungswissenschaften sowie fachlich interessierte aus Wissenschaft und Praxis.